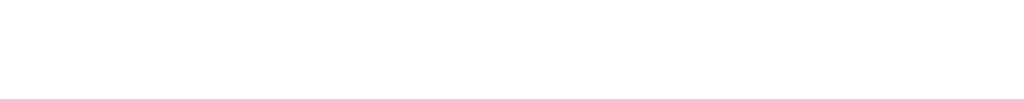Ist das nicht herrlich, ein goldbrauner Herbst. Es riecht nach Kürbissuppe und Chai Latte. Morgens früh frieren dir endlich wieder die Haare ein, wenn du dich nicht geföhnt hast. Abends willst du einfach nur noch ab aufs Sofa, Decke drüber, fertig. Natürlich nicht ohne vorher noch den richtigen Soundtrack anzumachen. Wie zum Beispiel das neues Album „Die traurigen Hummer“ von Moritz Krämer. Denn das passt nicht nur musikalisch zur gediegenen Jahreszeit, auch die Texte sind kuschelig und weich. Also, Kopfhörer auf und Fußsohlen an die knallheiße Heizung pressen, los gehts!
Vorab solltet ihr vielleicht wissen: Moritz Krämer ist ein Held für mich. Ein Held, der deutschsprachige Popmusik gerettet hat und anscheinend mit seiner Aufgabe noch nicht fertig ist. Seit ich damals seinen TV Noir-Auftritt mit dem Song „Der kleine Spatz“ gesehen habe (angucken!), bin ich hin und weg. Freakin’ 10 Jahre her. Dann kam seine Band Die Höchste Eisenbahn. Alle so: wow, deutsche Popmusik ist ja doch nicht scheiße!
Wie er Geschichten erzählt, so beiläufig und unaufdringlich, ist einzigartig. Andere Songwriter wären wahrscheinlich froh, wenn ihnen allein die Wörter eingefallen wären, die Moritz Krämer manchmal so charmant verschluckt.
Riesenbaby
Bei seinen Texten ist es oft so, dass ich schon eine Weile zuhöre, bevor ich merke, dass ich schon komplett in der Geschichte versunken bin. Irgendwie ist da so etwas unwiderstehliches, das mich in jedem Muskel die Anspannung verlieren lässt und ich nur noch reglos lauschen möchte. Gleich beim ersten Track des Albums. Ein Klavier, eine packende erste Zeile, dann eine packende zweite. Einsatz Drums: Knochentrocken und groovy in Verbindung mit dem abgedämpften Bass.
„Nackt und einsam“ fragt zwar nicht die Gretchenfrage, aber trotzdem stellt der Song textlich schon ziemlich tiefgründige philosophische Thesen auf. Es geht zum Beispiel um „den großen Plan“, um Zufälle, um den:die-da-oben. Wer sitzt dort und lenkt? Nur ein Riesenbaby (Stichwort: Generation Teletubbies!)? Wem das für den Einstieg vielleicht schon ein bisschen too much ist: Keine Sorge. Wenn Moritz Krämers Texte komplexe Brüche sind, ist er selbst der liebe Mathenerd, der sie alle im Kopf für dich kürzen kann.
Zwischen den Zeilen könnte es auch einfach um das überwältigende und zugleich erleichternde Gefühl gehen, nach großer Anstrengung mal etwas zu entgleisen und in einen unerklärlichen Lachkrampf zu geraten. Wenn du einfach so ein bisschen drüber bist und die Selbstbeherrschung verlierst, weil es ein langer Tag war. Und du hast eh schon wenig getrunken und so. Ich glaube er will uns damit sagen, dass man manchmal auch ein paar Dinge unkontrolliert durchwinken muss. Lieber einmal zu viel ohne Grund lachen, als einmal zu wenig.
Der zweite Song „Die traurigen Hummer“ lässt Krämers Vorliebe zu einfachen und einprägsamen Erkennungsmelodien deutlich werden, die uns noch bei vielen seiner Songs in den Intros begrüßen werden. Und außerdem gibt es im Refrain immer diese kleine Klarinettenmelodie, oh my goodness, ist das schön! So sanft und gefühlvoll angeblasen, da will ich mich reinlegen und nie wieder eine andere Melodie hören.
Diesmal etwas schneller im Tempo erzählt er uns von den traurigen Hummern, die darauf warten gekocht zu werden. Von den traurigen Hummern als Bild für das Abstellgleis. Das aussortierte, ausrangierte, alte Eisen. „Jeder muss gucken wo er bleibt“. Es geht um Schuld und Unschuld. Und um Pech und Glück und alle Graustufen dazwischen. Mir fällt beim Hören auf, dass diese armen Hummer, dem Tode geweiht, auch für etwas exklusiv Auserwähltes stehen. Für das Erlesene, die Delikatesse. Das macht deutlich, dass der Grat zwischen „kann weg“ und „muss bleiben“ manchmal eben doch sehr schmal ist.
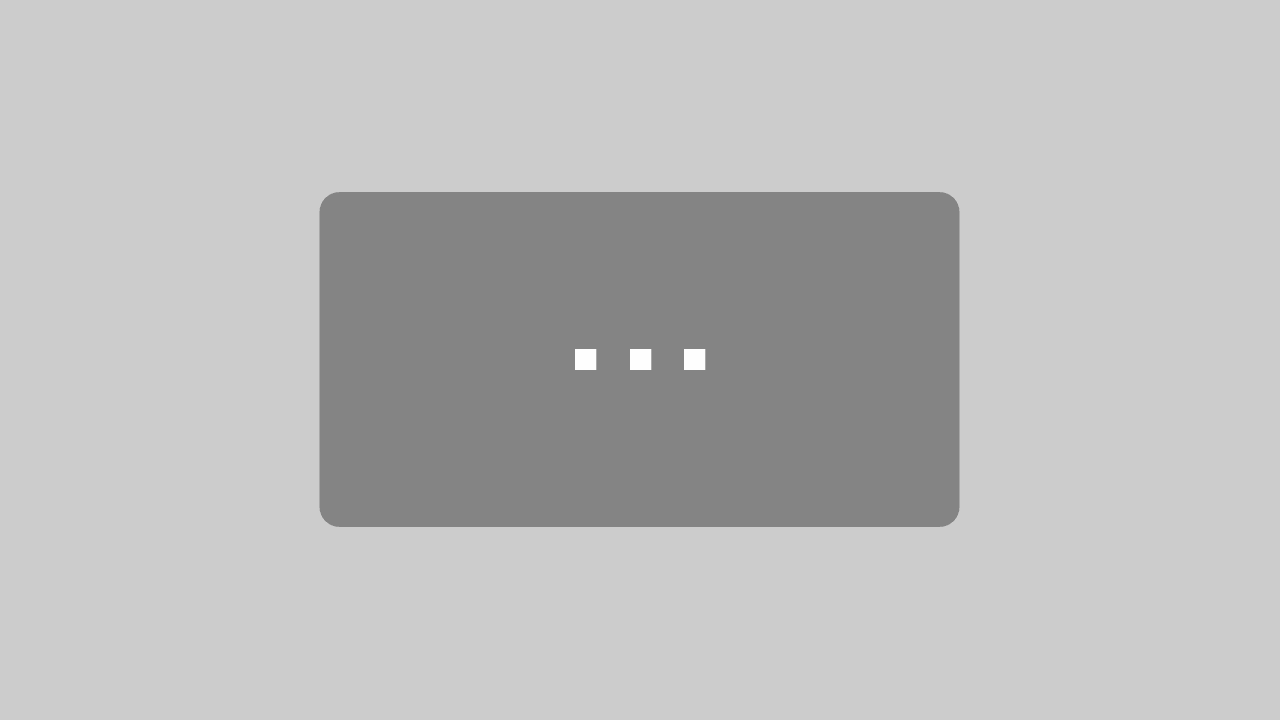
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Fake it till you make it
Eine magische Verbindung haben für mich die Songs „Auffliegen“ – „Verlieren“ – „Beweisen“.
Auffliegen – Verlieren – Beweisen. Da erzählen schon allein die Titel eine ziemlich interessante Geschichte. „Auffliegen“ hat mich sofort an „First day of my life“ von den Bright Eyes erinnert. Die ganz zart angeschlagene Akustikgitarre und die folkigen Akkorde untermalen mal leiser, mal lauter den Spannungsaufbau der Lyrics. Diese enttarnen nämlich nach und nach den kleinen Hochstapler, der in uns allen steckt. Spenden allerdings auch das Schulterklopfen, das wir manchmal brauchen, um vor Nervosität nicht die Wände hochzulaufen. Er vermittelt für mich hier einen sehr wichtigen Ansatz, nämlich dass es überhaupt nicht schlimm ist, nicht immer alles zu können. Auch wenn alle Freunde um dich herum scheinbar Überflieger sind und von dir dasselbe erwarten. Aber hey, am Ende bleibt uns immer noch: Fake it till you make it!
In „Verlieren“ zeichnet Moritz Krämer uns den Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfgesellschaft. Es ist nicht alles Müll, was stinkt. So in etwa. Er singt es uns etwas schöner: „Was kaputt geht kann man auch wieder reparieren“. Dabei pumpt musikalisch der 2010er Indiepuls, den wohl auch Balthazar oder Mac DeMarco schon mit zwei Fingern abgetastet haben, wieder auf 180.
Wie schön, dass dieses Herz auch noch zu schlagen scheint. Insgesamt wird für mich hier eins der Hauptmotive der ganzen Platte herausgestellt: Vorsichtiger Optimismus. Egal was so passiert, egal wie groß der Scherbenhaufen ist, Moritz Krämer ist der Ansicht, dass wir immer die Möglichkeit haben, von vorne zu starten. Ob falsche politische Entscheidung oder zerbrochene Freundschaften. Und das alles zwar immer ironisch mit Augenzwinkern, dabei aber so angenehm ehrlich.
Das zeugt mal ausnahmsweise nicht vom „Erwachsenwerden“ sondern vom „Erwachsensein“. Ich finde „reif“ ist so ein blöder Begriff, aber auf eine Weise ist Krämers Sicht auf vermeintliche Niederlagen eine weise (ok steinigt mich dafür) (es ist schon spät). Aber mal ohne Flax, als waschechter Erwachsener muss man Niederlagen auch mal verkraften können. Das kommt an bei mir.
„Beweisen“, letzter Song in meiner kleinen Dreierreihe, spielt mit einer ähnlichen, ganz losgelösten Auffassung von Erwartungshaltungen. Denn hier bringt er uns näher, dass es ab und zu auch einfach gut tut, Dinge NICHT tun zu müssen. „Keiner muss was beweisen“, weder sich selbst, noch irgendwem sonst. Ich mag auch die Vorstellung, dass es in diesen drei Songs vielleicht um Selbstliebe und -akzeptanz geht. Und um ein gutes Gefühl, gerade dann, wenn es in manchen Lebenssituationen überhaupt keinen Grund für ein gutes Gefühl gibt.
Wormhole

Zum Erwachsensein gehört auch, reflektiert in die Vergangenheit zu schauen und daraus zu lernen. Solche nostalgischen Rückblicke erleben wir zum Beispiel in Songs wie „Austauschbar“, „Schwarzes Licht“ oder „Jetzt“. Jinglehaft und unverschämt fröhlich tönt da beispielsweise „Austauschbar“, mit dem Wechselspiel von Flöten- und Klaviermelodie, ins Ohr. „Nichts ist nur ein Wort“, eine Zeile mit doppelter Bedeutung, so unauffällig genial, dass man es fast nicht bemerkt: „Nichts“ ist nur ein Wort, aber auch „Nichts ist NUR ein Wort“. Gehirnknoten. Schwarzes Loch. Wormhole. Vakuum. Tja.
„Schwarzes Licht“, das Feature mit Larissa Pesch, beginnt mit einem (etwas) schwülstigen Orchesterintro, das mich ein wenig an die Filme erinnert, die ich mit meiner Oma im Vorabendprogramm im Ersten geschaut habe, wenn meine Eltern mal ins Kino wollten. Hier beschreiben die beiden Sänger:innen, wie Menschen sich leicht in festsitzenden Schemata verfangen können. Dass Zufriedenheit auch mit Sicherheiten zusammen hängt, die man ab und zu auf der Stelle bereit sein muss, aufzugeben.
Jetzt muss man natürlich ein wenig aufpassen, was in Krämers Texten noch persönliche Empfindungen sind, und was schon Rollenprosa ist. Allerdings kommt es mir so vor, als wolle er mit diesem Album einige Kapitel in seinem Leben abschließen. So klingt dieses Album nämlich stellenweise so, wie die alten Singer-Songwriter-Solosachen von ihm, an anderer Stelle aber doch sehr viel moderner und irgendwie auch nach seiner jetzigen Band, der Eisenbahn. Vielleicht ein Goodbye an den Singer/Songwriter Moritz Krämer?
Nimmt man sich beispielsweise das Stück „Rhythmus“ vor, das sicherlich auch einigen Bilderbuch-Fans gut gefallen wird, wird klar, in welche musikalische Richtung es wohl weitergehen wird. Da flowt sein Gesang im absoluten Einklang mit Schlagzeug und Bass und der Song macht seinem Titel alle Ehre.
„Ich hab meinen Rhythmus, ich lauf in meinem Takt“
Eine ziemlich simple, aber wahrheitsgemäße Selbsteinschätzung, wenn man sich seine Karriere einmal anschaut. Er ist sich treu geblieben, hat sich nicht verbogen und es niemandem recht machen wollen mit seiner Musik. Das ist in der Popmusik ja nicht immer so einfach, denn es geht zum einen darum, viele Menschen anzusprechen. Und zum anderen darum, nicht allzu beliebig daherzukommen. Ziemlich ironisch, dass gerade dieser Song 1.) auf einem Standard Blues Schema aufbaut und 2.) wie gesagt, irgendwie sehr an eine moderne, österreichische Indiepop Band erinnert. Und trotzdem ist es ein verdammt guter Song.
Fazit
„Die traurigen Hummer“ ist ab der ersten Sekunde ein Album zum Chillen. Es zieht den Stress aus dem Körper und öffnet ganz selbstverständlich die Rezeptoren, die die Ohren spitzen lassen. Und genaues Hören ist wichtig, um die Tiefe und Schönheit dieser Musik ganz aufnehmen zu können.
Die Songtexte von Moritz Krämer sind für mich wie Ratschläge von den allerbesten Freunden. Sie lassen mich einen Moment lang zur Ruhe kommen, nehmen mir meine Selbstzweifel und muntern mich auf. Musikalisch serviert er uns die Mixtur aus dem jazzigem Folk seiner frühen Schaffensphase und dem mordernen, tanzbaren Indiepop, der zum Glück noch nicht durch den Mainstream-Radio-Fleischwolf gedreht wurde. Wenn ihr mal ne Pause braucht — spielt dieses Album.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Fotocredit: Max Zerrahn