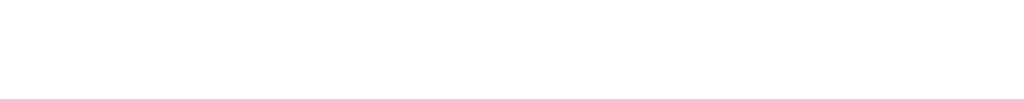Endlich, seit dieser Woche ist das neue Album „Cavalcade“ von black midi draußen. Zugegebenermaßen habe ich darauf jetzt wirklich lange fingernägelkauend gewartet und möchte jetzt natürlich auch ausführlich darüber berichten. Vorweg sei allerdings gesagt: auch das zweite Album ist nichts für schwache Nerven.
Erstmal aber einen Schritt zurück. Im Jahre 2019 veröffentlichte black midi aus London, damals noch vierköpfig, ein absolut unfassbares Debütalbum: „Schlagenheim“. Die Musikwelt stand Kopf, sowas hatte man noch nicht gehört. Das war roh, das war brutal. Das war innovativ und technisch versiert. So einig war man sich in Kritikerkreisen. Wo man las, nur Lob und Preis für diese zeitweise ziemlich gehypte Band. Und ich glaube, eine Band hat es definitiv erst geschafft, wenn nicht nur Gleichaltrige himmelhochjauchzend in Freudentränen ausbrechen, sondern auch täglich dutzende Liebesbriefe von Ü-50 Rezensenten zur Tür reinflattern. Auch ich bin damals in Flammen aufgegangen für diese Band, vor allem nachdem ich diese eine KEXP-Livesession gesehen hatte. So routiniert und selbstbewusst habe ich Musiker, die damals im Schnitt nicht mal 20 Jahre alt waren, noch nie erlebt. Also, um mich war es auch geschehen.
Während ich das hier schreibe muss ich wirklich schon sehr lachen, denn trotz der guten Kritiken habe ich in meinem Freundeskreis genau nur 1,5 Personen, die diese oben erwähnte Begeisterung mit mir teilen. Und glaubt mir, ich habe black midi wirklich mehr als ein Mal meinem sehr verehrten Publikum (meinen restlichen Freunden) vorgespielt und die Tanzfläche damit leergefegt. Die Reaktion darauf war eigentlich immer: „Mach das bitte aus. Das ist Krach“.
Und wenn sich „Krach“ so anhört, als würden zwei Elefantenherden mit extrem hoher Geschwindigkeit aufeinander prallen, und in der Mitte, bei einem Aufprall epischen Ausmaßes, einen erneuten Urknall auslösen — stimmt, dann ist es Krach. Aber ja, mal im Ernst. Das ist einfach extrem verstörende und laute Musik, damit können nicht alle etwas anfangen und das ist auch völlig ok. Es ist stellenweise so bedrückend komplex und überwältigend, dass ich Angst beim Hören habe. Haha. Und das finde ich geil.
When John L comes to town
Kommen wir nun also zu „Cavalcade“. Eine traurige Nachricht gab es für alle Fans schon recht früh, Gitarrist Matt Kwasniewski-Kelvin wirkt auf dem neuen Album wegen psychischer Probleme nicht mit. Und somit wird aus dem Quartett ein Trio. In der Theorie zumindest, denn für das Album konnte die Band den Saxophonisten Kaidi Akinnibi und den Keyborder Seth Evans gewinnen, die dem gesamten Bandsound einen ganz neuen Schliff verpassen konnten. Dass sich da nämlich schon einiges verändert hat, merkt man relativ schnell. Während das Debüt „Schlagenheim“ von stark verzerrten Gitarrenriffs, skurrilen Geräuschen und lauten Drums geprägt war, kommt „Cavalcade“ an einigen Stellen schon fast brav daher… An einigen Stellen. An anderen Stellen brettert black midi natürlich wie eh und je, dass mir Hören und Sehen vergeht. Interessanterweise ist das neue Album sowohl zugänglicher, als auch noch komplizierter als sein Vorgänger. Wie das zusammengeht? Ehrlich, keine Ahnung! Ich verstehe bei dieser Band eigentlich gar nichts mehr.
„John L“ ist der Opener von Cavalcade. Das „L“ steht hier übrigens für „fifty“ – fünfzig. Also die lateinische Zahl. Hier kommt einiges zusammen: Ein fast schon orchestrales Arrangement mit Bläsersatz und Streichern, schnell, kurzatmig und undurchsichtig. Der Song stoppt und startet zwischendurch immer wieder ganz abrupt, sodass ich zumindest Schwierigkeiten habe, dem Konstrukt zu folgen. Das sorgt für Verwirrung und Desorientierung (die Angst beim Hören habe ich ja schon mal erwähnt, hier ist sie). Sänger und Gitarrist Geordie Greep führt uns in seinem übertrieben artikulierten Sprechgesang eine Art Gedicht vor, das für mich irgendwie wie ein Drehbuchauszug oder eine Regieanweisung klingt. Zwischendurch fasst er nämlich immer wieder erläuternd zusammen: „This is the scene on Main Street when John L comes to town“.
Er scheint uns also eine Geschichte erzählen zu wollen und erinnert mich dabei an einen Moritatensänger mit Drehorgel auf den Straßen des 19. Jahrhunderts. Der Song handelt von einem bizarren Götterkult und dem Fall des Kultführers, ebenjener John L. Im Musikvideo wird dieser Kult durch eine beeindruckende Tanzperformance von gender- und skincolorneutralen Menschen dargestellt. Das ist für mich wieder so ein Moment gewesen, in dem Musik ihr wahres Potenzial erst zusammen mit der visuellen Umsetzung entfaltet. Diese schnelle Rhythmik, Stop/Start, Chaos – all das wird durch die Performance geordnet und erträglich.
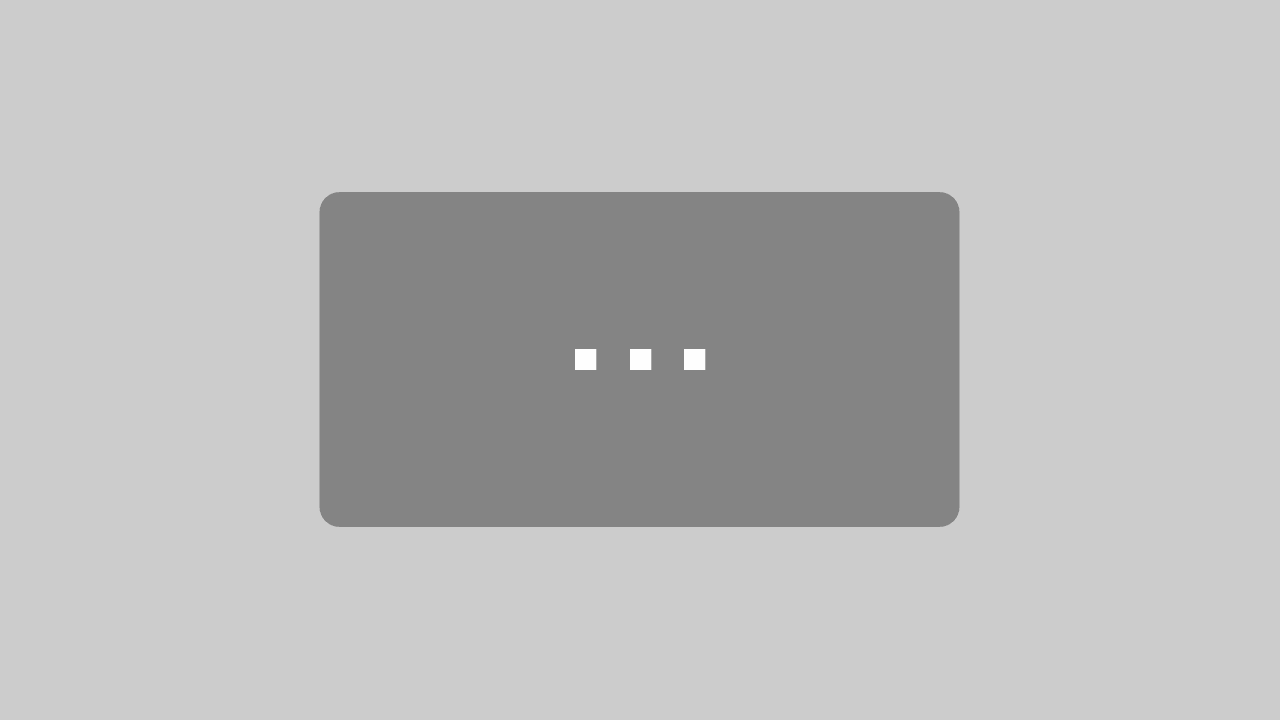
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
The joy of performance
„Erträglich“ klingt wirklich so, als würde ich mich hier die ganze Zeit zwingen, mir black midi in die Hirse zu löffeln. Das stimmt aber nicht. Denn auch wenn viele Stücke viel Aufmerksamkeit und Zeit benötigen, kommen manche Stücke auch ganz ohne aus. Wie zum Beispiel der Track „Marlene Dietrich“. Wirklich eine Neuheit, denn dieser Song ist ein eigentlich ein Jazz-Chanson. Sehr zugänglich! Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie absurd das ist, wenn man das erste Album kennt. Da wurden gefühlt pausenlos nur die Instrumente verdroschen und den besinnlichen Momenten wenig Platz gelassen. „Marlene Dietrich“ schwingt sich richtig lauschig in die Ohrmuschel. Das tut einfach gut nach diesem Höllenritt mit „John L“.
Als ich „Cavalcade“ das erste Mal nebenbei laufen ließ, habe ich doch tatsächlich gedacht, ich höre auf Shuffle und Nina Simone hätte sich in die Playlist geschlichen. Ohne Mist – Geordie Greep kann richtig singen! Bisher klang seine Stimme immer seltsam verstellt und hatte glaube ich eher den Zweck zu irritieren, als zu begeistern. Aber mir zumindest gefällt diese neue Abwechslung. Es soll auch tatsächlich nicht bei dem einen Mal bleiben. Im Song geht es, wie könnte es anders sein, um die Schauspielerin Marlene Dietrich herself. Geordie sagt dazu selbst: “She was someone who couldn’t really dance, couldn’t really sing, wasn’t the greatest actor and spent all her years in Hollywood on the wrong side of 30, but she had that indefinable but undeniable quality: incredible presence. She embodies the joy of magic and the joy of performance.”
Witzigerweise finde ich dieses Zitat auch ziemlich passend für black midi. Klar – technisch sind hier absolute Könner am Werk, keine Frage. Vor allem Schlagzeuger Morgan Simpson kann eigentlich kein Mensch, sondern muss Maschine oder Gott sein. Aber was diese Band so besonders macht, ist ihre Performance und die unglaubliche Kraft, die sie so elegant entfaltet. Deswegen freut es mich auch so, dass sie im Song „Chondromalacia Patella“ neben ihrem Math-Rock-Gefrickel auch zwischendurch noch mal die Sau rauslassen und übertrieben laute Unisono-Hits raushauen. Jeder einzelne trifft mich ins Herz.
Schrammel Schrammel ist nicht mehr
Apropos: Herzstück ist für mich unter anderem übrigens „Slow“, das von Bassist Cameron Picton gesungen wird. Ich mag den Gegensatz des schnellen Instrumentals und der lethargischen Gesangsdarbietung. Und außerdem finde ich es super, dass das Stück „Slow“ heißt, aber eigentlich einfach super schnell gespielt ist, mit schnellen Hihats und Snare-Ghostnotes. Überzeugend sind für mich auch die ruhigen Passagen, die sich richtig verträumt aufbauen. Und das Saxophonsolo am Ende ist einfach die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Besonders packt mich eine bestimmte Stelle in den Lyrics, die sich so bedrohlich aufschaukelt und mir andauernd einen Ohrwurm verpasst:
“Slowly it falls and slowly it dies
Slowly it crumbles right under my eyes
And it takes so long”
Mit ruhigeren Passagen geht es auch weiter, in „Diamond Stuff“ findet man erst ganz zum Schluss mal ein Schlagzeug. Die meiste Zeit wird der Gesang, auch dieses mal wieder von Cameron, nur durch zwei Töne auf einer Mandoline (oder so) begleitet. Durch die plötzlichen Basstöne ab und zu, wird hier eine ganz intime Atmosphäre geschaffen, die mir Gänsehaut verpasst. Erst ziemlich spät ergießt sich das alles in einen rhythmisch geschichteten Groove, der mich teilweise an Radiohead erinnert. Ich bin übrigens immer mehr der Auffassung, dass „Cavalcade“ in erster Linie mal einfach ein AKUSTISCHES ERLEBNIS darstellt. Als solches sollte man es auch hören, denn hier noch in Genre-Schubladen einsortieren zu wollen, ist „verlorene Liebesmüh“.
So Leude! Und das war gerade eine Shakespear-Überleitung (wer es nicht bemerkt hat)! Kurz Applaus bitte. Denn das gesamte Konzept scheint dieses Mal sehr ans Theaterspiel angelehnt zu sein. Nicht nur bei den Regieanweisungen von „John L“, auch mit „Marlene Dietrich“ und diesem Song hier, „Diamond Stuff“, wird darauf Bezug genommen. Im Text geht es zwar nicht um Schauspielerei, sondern um eine Mumie (oder Leiche?), die in einer Diamantenmiene gefunden wird — aber das alles aus der Ich-Perspektive der Mumie, was die verschiedenen theatralischen Erzählperspektiven verdeutlicht.
Auf die Dosis kommt es an

„Dethroned“ beginnt mit einem smoothen Saxophonintro, so hätte man es vielleicht auch in den Straßen New Yorks der 70er Jahre gehört, ihr wisst schon, mit dampfenden Gullideckeln und so. Ich komme einfach nicht drum herum es auszusprechen: ist euch schon mal aufgefallen, dass das Saxophon eine extreme Renaissance erfährt gerade? Gerade im Post-Punk (wo man es wirklich überhaupt nicht erwartet hätte), schleppen die Bands wieder Saxophonisten mit zum Gig. Nur als Beispiel: Squid, Iceage, Black Country New Road, Protomartyr… sie alle machen das auf ihren neuen Alben. Und jetzt auch black midi.
„Dethroned“ ist vielleicht einer der Songs, mit dem ich es bei meinen Freunden noch mal versuchen würde. Er ist zwar vertrackt und geht einige Abbiegungen, die andere Bands abgekürzt hätten, aber er grooved einfach auch die ganze Zeit durch. Was vor allem an der tighten Bassline in Verbindung mit den Drums liegt. Hier erinnert mich der Sound auch stark an King Crimson, der legendären Prog-Rock Band aus den 70ern („21st Century Schizoid Man“, hat auch Kanye mal gesampled).
Das Album ist mit acht Songs einigermaßen kurz geraten. Ehrlich gesagt finde ich das aber gut. Das ist so, als hätte black midi gewusst, dass sie ihre Musik sparsam und in kleinen Dosen verabreichen müssen. Denn ein Overload ist bei den KonsumentInnen durch die Komplexität und das vermeintliche Chaos wohl schnell erreicht. Dafür ist allerdings das letzte Stück „Ascending Forth“ über neun Minuten lang. Die gepickte Akustikgitarre ist das wiederkehrende Element und führt durch den Song. Die dynamischen Peaks und Troughs machen den Song super spannend. Hier baut sich mal ein lauter Swell auf, dort baut er sich wieder ab und reduziert sich auf Geordies Stimme und die gezupfte Gitarre.
Am meisten erinnert mich der Song an Jeff Buckley, der in seinen Songs auch Jazzpatterns mit einer ähnlich intonierten Stimme kombiniert hat. Und so orchestral arrangiert wie „Cavalcade“ angefangen hat, so endet es auch: tiefe Bläser, perkussives Schlagzeug und die Musik folgt dem Text, in dem es um einen von Schreibblockaden geplagten Künstler und dessen Schicksal geht. Durchkomponiert nennt man das und hier merkt man am deutlichsten, wie viel Detailarbeit in dieser Musik steckt.
Fazit
„Cavalcade“ bedeutet auf deutsch etwa „feierliche Parade“. Und all diese auf diesem Album von black midi geschaffenen Charaktere, schreiten an uns in dieser Parade vorbei. Wir stehen am Rand, gaffen, glotzen, träumen. Wie ich weiter oben schon schrieb, ist dieses Album als Gesamtkunstwerk und akustische Attraktion zu betrachten. Ich könnte niemals nur einen Song auswählen, um diesen beispielsweise in eine unserer Playlists bei untoldency zu packen. Erstens, weil ich das wirklich niemandem antun möchte und zweitens, weil diese Musik sowohl Kontext als auch Zeit benötigt. Wenn ihr mich fragt, ist das ein Meisterwerk der verschachtelten Rockmusik geworden. Ich glaube man kann sich gar nicht weiter weg von Pop bewegen, denn hier will und muss nichts gefallen.
Nicht nur das musikalische Songwriting, auch die Texte sind literarisch hoch anspruchsvoll. Wahrscheinlich habe ich nicht mal 25% verstanden, von der Sprachhürde und den vielen ultra komplizierten Wörtern mal ganz abgesehen. Die verrohte Brutalität des ersten Albums ist kaum mehr zu spüren, stattdessen hat Jazz Einzug erhalten. Und das ergänzt sich erstaunlich gut mit den Post-Punk-, Metal- und Rockeinflüssen auf „Cavalcade“. Das glaubt ihr mir nicht? Kein Wunder. Würde ich es selbst nicht immer wieder anhören, um zu checken ob das auch wahr ist, ich würde es mir selbst nicht glauben.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Fotocredit: Yis Kid